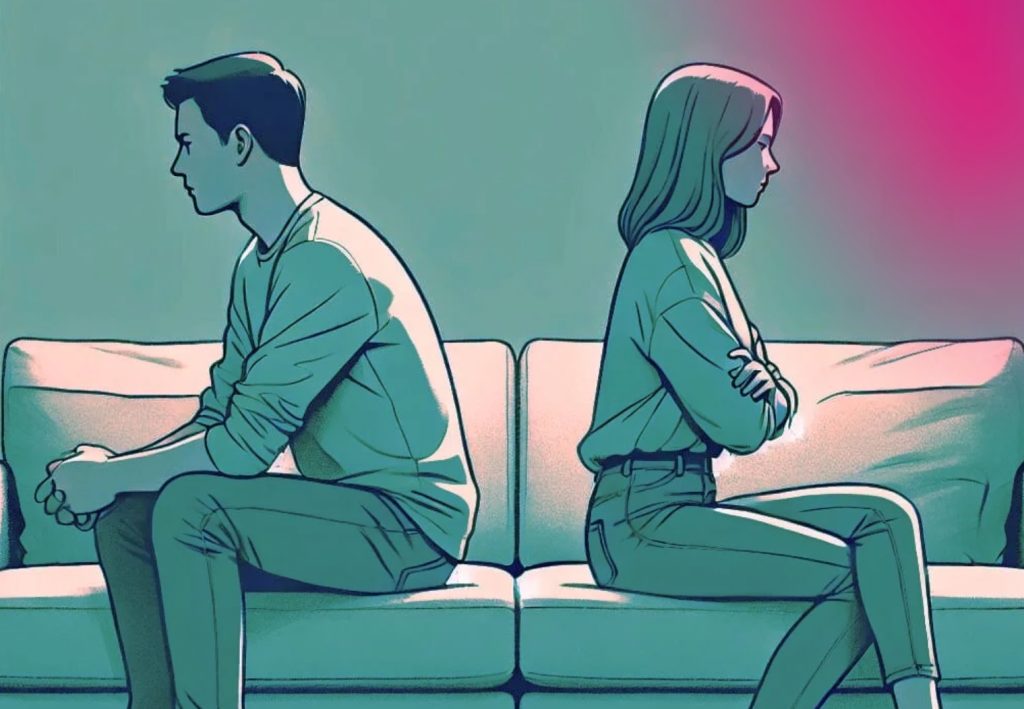Die Reise von „Frau Gorbatschow“
von Emilie Bitsch

Eine Matrjoschka mit feiner blau-weißen Bemalung steht auf der Holzgarnitur gegenüber dem Esstisch. Dort schenkt sich eine kleine, blondhaarige Frau, mit strahlend grau-blauen Augen, etwas Milch in ihren Tee. „Ich trinke morgens immer Çay. Ist so ‘ne Tradition in Kasachstan.” Ludmila Mitusowa, die Dame, die mit einem leichten russischen Akzent spricht, ist in den 60er Jahren in der ehemaligen Sowjetunion geboren. In einem kleinen Dorf namens Viktorovka, im heutigen Kasachstan.
Bei einem heißen Çay und „Suschki“, einem russischen Knabbergebäck, blättert sie durch das mit rotem Leder überzogene Fotoalbum und zeigt einige Fotos aus ihrer Kindheit. „Also, das Leben dort kannst du nicht mit dem Leben hier vergleichen.“ In ihrem Dorf hatte jeder seinen eigenen Bauernhof mit Äckern und Tieren, an dem sie, gerade im Sommer, von früh bis spät mithelfen musste. Vor der Schule noch die Kühe melken, nach der Schule gemeinsam mit anderen Familien auf einem Feld Kartoffeln ernten und abends die Tiere nochmals füttern. „So leben die wenigsten heute“, sagt Ludmila, „wir kennen das nicht anders. Wir sind so aufgewachsen.“ Doch die Arbeit auf ihrem Hof mochte sie nie. Sie hatte keine Wahl, sie musste helfen, da sie sich sonst nicht versorgen und leben konnten.
„Ich will keine Ärztin werden, ich ekel’ mich vor Blut“
Schon früh wollte Ludmila etwas in Richtung Medizin machen, sagte sich aber immer, dass sie sich vor Blut ekelte, obwohl sie auf ihrem Hof die Tiere selbst schlachteten. „Naja, das war meistens meine Ausrede dafür, keine Ärztin zu werden. Ich muss sagen, ich war nach der Schule recht faul.“ So entschied sie sich, mit 16 Jahren in Petropawl, im Norden von Kasachstan, ihre Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen-Assistentin zu beginnen. Als sie das erzählt, zeigt Ludmila auf ein Bild, auf dem fünf Frauen, ihr eingeschlossen, mit weißen Kitteln und weißer Kopfbedeckung zu sehen sind. „Es war eine schöne Zeit. Ich wollte Menschen helfen und habe damit meinen Traumberuf gefunden”, erinnert sie sich. Theoretisch hätte sie danach an einer renommierten Universität ihre Apothekerin-Studium beginnen können. Doch: „Dann hätte mein Mann noch länger auf mich warten müssen, bis wir geheiratet hätten, also habe ich mich dagegen entschieden.“
Ihr Mann Oleg, der dort als Flug-Navigator arbeitete, hat deutsche Vorfahren. „Wir kennen uns seit der ersten Klasse, er hatte mich damals immer zur Schule gebracht“, schmunzelte sie „aber erst nach der achten Klasse sind wir zusammengekommen.“ Sie bekamen mit 21 Jahren, für damalige Verhältnisse spät, ihre erste Tochter Aljona. Sie zeigt dabei auf ein Bild, indem ein kleines Mädchen, noch ohne Haare, einen Plüsch-Affen in der Hand hält.
1997 entschied sich die Familie, nach schweren Schicksalsschlägen, wie der frühe Tod ihrer Eltern und ihres Bruders, nach Deutschland als Spätaussiedler zu kommen. Vor allem wegen der „Perestroika“, der Beginn des Zerfalls der Sowjetunion. „Wir überlegten lange, ob wir nach Deutschland ziehen sollen. Im letzten Jahr, bevor wir hierher kamen, hatte mein Mann gar kein Gehalt bekommen, aber wir hatten noch einiges angespart. Doch wir wussten wir konnten so unserer Tochter keine gute Zukunft bieten.“
Nicht nur sie kamen als Spätaussiedler hierher. Spätaussiedler sind nach der gesetzlichen Definition des Bundesvertriebenengesetzes deutsche Volkszugehörige, die die Republiken der ehemaligen Sowjetunion nach dem 31. Dezember 1992 verlassen haben. Gerade in den 90er Jahren wanderten jährlich über 400.000 ein, heutzutage sind es unter 10.000. Stand 2020 leben rund 2,5 Millionen Spätaussiedlerin Deutschland.
„Ihre Stimme und Gesicht werde ich niemals vergessen“
Die Einreise verlief problemlos. Sie wurden nach Mannebach, Thüringen, in ein Wohnheim gebracht, in dem sie sich zu dritt ein Zimmer teilten. Ludmila hebt eine Zeichnung ihrer ersten Tochter hoch. Eine Zeichnung von einem Haus mit ganz vielen Menschen. „In diesem Heim lebten sehr viele Familien, teilweise sogar zu sechst in einem Zimmer.“ Es war anfangs schwer für sie, allein wegen Ausländerfeindlichkeiten. Ihre Diplom-Anerkennung bekam sie nicht. „Ich pendelte ein Jahr lang immer nach Erfurt, um meine Ausbildung hier anerkennen zu lassen.“ Drei Prüfungen bestand sie, die letzte nicht. Auch nicht beim zweiten Versuch. „Der Prüfer mochte mich nicht. Man hat ihm angesehen, dass er Ausländer hasste. Ich konnte somit also meinen Traumberuf nicht ausführen.“ Aber gerade die Mitschüler machten ihr zu schaffen. „Ich kam nach Hause und weinte, weil ich so einen Hass nicht kannte. Eine Mitschülerin, ihre Stimme und Gesicht werde ich niemals vergessen, nannte mich immer „Frau Gorbatschow“ und machte sich über mich lustig. Ich hätte niemals erwartet, dass es hier sowas geben würde.“
Man ist nie zu alt, um seinen Traumberuf auszuleben
Deswegen war sie froh, dass sie nach Frankfurt ziehen durften. Sie arbeitete dort bei Toom, bis ihre zweite Tochter zur Welt kam, dann als Putzkraft und parallel im Restaurant als Köchin. Bis ihr Mann sagte, dass es so nicht weitergehen kann. Er fand für sie einen Job in einer bekannten Apotheke in Darmstadt. Anfangs war sie noch unsicher, ob sie das wirklich machen sollte. Doch ihre Familie stand komplett hinter ihr und sie fand den Mut, dort anzufangen. Nach einem Jahr Praktikum mit anschließender Prüfung für ihre Anerkennung, durfte sie nach 18 Jahren wieder ihren Traumberuf ausüben. „Ich war noch nie glücklicher, als ich endlich anfangen durfte. Ich habe das vor allem meinem Mann zu verdanken, aber auch, dass ich den Mut fand mit 48 Jahren doch noch meinen Traumberuf auszuleben.“
Sie bereut es nicht, hierhergekommen zu sein. „Klar, es gab Hürden, aber allein weil unsere Kinder hier einfach eine bessere Zukunft haben und wir hier sicherer leben, bereue ich es nicht. Gerade das letzte Jahr in Kasachstan, als wir im Winter teilweise ohne Strom und Heizung auskommen mussten, war es sehr schwer. Es ist hier alles zwar manchmal etwas stressiger, weil es nicht meine Muttersprache ist, aber ich fühle mich hier wohl und bin froh, dass wir hierherkommen durften.“ Noch in ihrer Erinnerung schwelgend schließt sie das mit rotem Leder überzogene Fotoalbum.
- Darmstadt: Studentisch, klein und heimisch – Ein ErfahrungsberichtDarmstadt: Studentisch, klein und heimisch – Ein Erfahrungsbericht von Pauline Dörrich (24.07.2024) Zum Studienstart gehört bei vielen angehenden Studierenden ein Ortswechsel dazu. Raus aus Hotel Mama und der bekannten Umgebung, rein in die eigenen vier Wände und in eine neue Stadt. So auch für den 21-jährigen Justus Kress aus Düsseldorf. Pauline Dörrich hat für ach_dasta… Weiterlesen »Darmstadt: Studentisch, klein und heimisch – Ein Erfahrungsbericht
- „Ich möchte den tödlichen Witz entwickeln!“Elias Mantwill und Linus Moerschel haben mit Martin Sonneborn darüber gesprochen, was für ihn Satire bedeutet, welche Grenzen diese hat und wie er Satire in der Politik verwenden möchte.
- „Da hätte ich schon rennen sollen“ – Marie über ihre toxische BeziehungMarie ist 21 Jahre alt. Vor fünf Jahren war sie in einer toxischen Beziehung gefangen, Mitte 2021 trennte sie sich von ihrem Ex-Freund. Im Gespräch mit ach_dasta! berichtet sie über ihre Erfahrungen.